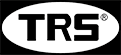Die Leistungsfähigkeit des Soundsystems wird gemeinsam durch die Schallquellenausrüstung und die nachfolgende Bühnenbeschallung bestimmt, die aus Schallquelle, Abstimmungs-, Peripherie-, Beschallungs- und Verbindungstechnik besteht.
1. Tonquellensystem
Das Mikrofon ist das erste Glied in der Kette des gesamten Beschallungs- oder Aufnahmesystems, und seine Qualität beeinflusst direkt die Qualität des Gesamtsystems. Mikrofone werden je nach Art der Signalübertragung in zwei Kategorien unterteilt: kabelgebundene und drahtlose.
Drahtlose Mikrofone eignen sich besonders gut zur Aufnahme mobiler Schallquellen. Um die Tonaufnahme in verschiedenen Situationen zu erleichtern, kann jedes drahtlose Mikrofonsystem mit einem Handmikrofon und einem Ansteckmikrofon ausgestattet werden. Da das Studio gleichzeitig über eine Beschallungsanlage verfügt, sollte das drahtlose Handmikrofon zur Vermeidung von Rückkopplungen ein nierenförmiges Nahfeldmikrofon für die Aufnahme von Sprache und Gesang verwenden. Gleichzeitig sollte das drahtlose Mikrofonsystem Diversity-Empfangstechnologie nutzen, die nicht nur die Stabilität des Empfangssignals verbessert, sondern auch dazu beiträgt, Empfangslücken und -ausfälle zu eliminieren.
Das kabelgebundene Mikrofon verfügt über eine multifunktionale, vielseitige und leistungsfähige Mikrofonkonfiguration. Für die Aufnahme von Sprache oder Gesang werden üblicherweise Nierenkondensatormikrofone verwendet. In Bereichen mit relativ festen Schallquellen können auch tragbare Elektretmikrofone eingesetzt werden. Richtmikrofone eignen sich zur Aufnahme von Umgebungsgeräuschen. Für Schlaginstrumente werden in der Regel dynamische Mikrofone mit geringer Empfindlichkeit verwendet. Für Streichinstrumente, Tasteninstrumente und andere Musikinstrumente kommen hochwertige Kondensatormikrofone zum Einsatz. Bei hohen Anforderungen an die Umgebungsgeräuschdämpfung sind Nahfeldmikrofone mit hoher Richtwirkung empfehlenswert. Für die flexible Positionierung von großen Theaterschauspielern sollten Schwanenhals-Kondensatormikrofone verwendet werden.
Anzahl und Art der Mikrofone können je nach den tatsächlichen Bedürfnissen des Einsatzortes ausgewählt werden.

2. Abstimmungssystem
Das Herzstück des Abstimmungssystems ist der Mischer, der die Eingangssignale von Schallquellen unterschiedlicher Pegel und Impedanz verstärken, abschwächen und dynamisch anpassen kann; mit dem angeschlossenen Equalizer wird jedes Frequenzband des Signals bearbeitet; nach der Einstellung des Mischverhältnisses jedes Kanalsignals wird jeder Kanal zugewiesen und an jedes Empfangsende gesendet; das System steuert das Live-Beschallungssignal und das Aufnahmesignal.
Bei der Verwendung des Mischpults sind einige Punkte zu beachten. Erstens: Wählen Sie Eingangskomponenten mit möglichst hoher Eingangsleistung und breitem Frequenzgang. Sie können entweder einen Mikrofon- oder einen Line-Eingang verwenden. Jeder Eingang verfügt über einen stufenlosen Pegelregler und einen 48-V-Phantomspeisungsschalter. So lässt sich der Eingangspegel jedes Kanals vor der Weiterverarbeitung optimieren. Zweitens: Um Rückkopplungen und Probleme mit dem Bühnen-Return-Monitoring bei Beschallungsanlagen zu vermeiden, ist eine möglichst präzise Entzerrung der Eingangskomponenten, Aux-Ausgänge und Gruppenausgänge ratsam und komfortabel. Drittens: Für mehr Sicherheit und Zuverlässigkeit sollte das Mischpult mit zwei Netzteilen (Haupt- und Standby-Netzteil) ausgestattet sein, die automatisch umschalten. Die Phasenlage des Audiosignals kann angepasst und kontrolliert werden. Die Ein- und Ausgänge sollten vorzugsweise XLR-Buchsen sein.
3. Peripheriegeräte
Die Beschallungsanlage vor Ort muss einen ausreichend hohen Schalldruckpegel ohne akustische Rückkopplung gewährleisten, um Lautsprecher und Endstufen zu schützen. Um die Klangklarheit zu erhalten und gleichzeitig die mangelnde Lautstärke auszugleichen, ist der Einsatz von Audioprozessoren wie Equalizern, Rückkopplungsunterdrückern, Kompressoren, Excitern, Frequenzteilern und Signalverteilern zwischen Mischpult und Endstufe erforderlich.
Frequenzentzerrer und Feedback-Unterdrücker dienen der Unterdrückung von Rückkopplungen, der Korrektur von Klangfehlern und der Gewährleistung klarer Klangwiedergabe. Der Kompressor verhindert Übersteuerung und Verzerrungen des Leistungsverstärkers bei hohen Eingangssignalspitzen und schützt so Verstärker und Lautsprecher. Der Exciter optimiert den Klang, indem er Klangfarbe, Tiefenstaffelung, Stereobild, Klarheit und Basswiedergabe verbessert. Der Frequenzteiler leitet Signale unterschiedlicher Frequenzbänder an die entsprechenden Leistungsverstärker weiter, die diese verstärken und an die Lautsprecher ausgeben. Für anspruchsvolle, klanglich hochwertige Programme empfiehlt sich der Einsatz einer dreistufigen elektronischen Frequenzweiche im Beschallungssystem.
Bei der Installation einer Audioanlage können viele Probleme auftreten. Eine falsche Beachtung der Anschlussposition und -reihenfolge der Peripheriegeräte kann zu Leistungseinbußen oder sogar zur Beschädigung der Geräte führen. Die Peripheriegeräte sollten grundsätzlich in einer bestimmten Reihenfolge angeschlossen werden: Der Equalizer wird nach dem Mischpult platziert; der Rückkopplungsunterdrücker darf nicht vor dem Equalizer angeschlossen werden. Befindet sich der Rückkopplungsunterdrücker vor dem Equalizer, lässt sich die akustische Rückkopplung nicht vollständig eliminieren, was die Einstellung des Unterdrückers erschwert. Der Kompressor sollte nach dem Equalizer und dem Rückkopplungsunterdrücker angeschlossen werden, da seine Hauptfunktion darin besteht, übersteuerte Signale zu unterdrücken und die Endstufe sowie die Lautsprecher zu schützen. Der Exciter wird vor der Endstufe angeschlossen; die Frequenzweiche wird bei Bedarf vor der Endstufe angeschlossen.
Um optimale Aufnahmeergebnisse zu erzielen, müssen die Kompressorparameter korrekt eingestellt werden. Sobald der Kompressor komprimiert ist, wirkt er sich negativ auf den Klang aus. Vermeiden Sie daher, ihn längere Zeit in diesem Zustand zu betreiben. Der Kompressor sollte im Haupt-Expansionskanal platziert werden. Grundprinzipien sind, dass die nachfolgenden Geräte möglichst keine Signalverstärkungsfunktion besitzen sollten, da der Kompressor sonst seine Schutzfunktion nicht erfüllen kann. Aus diesem Grund sollte der Equalizer vor und der Kompressor nach dem Feedback-Suppressor angeordnet sein.
Der Exciter nutzt psychoakustische Phänomene des menschlichen Gehörs, um entsprechend der Grundfrequenz des Schalls hochfrequente Obertöne zu erzeugen. Gleichzeitig ermöglicht die Tieftonerweiterung die Erzeugung reichhaltiger Tieftonanteile und verbessert so den Klang. Daher weist das vom Exciter erzeugte Schallsignal ein sehr breites Frequenzband auf. Ist das Frequenzband des Kompressors extrem breit, kann der Exciter problemlos vorgeschaltet werden.
Der elektronische Frequenzteiler wird bei Bedarf vor dem Leistungsverstärker angeschlossen, um durch die Umgebung und den Frequenzgang verschiedener Audioquellen verursachte Defekte auszugleichen. Sein größter Nachteil ist der aufwendige Anschluss und die komplizierte Inbetriebnahme, die zudem fehleranfällig sind. Mittlerweile gibt es digitale Audioprozessoren, die diese Funktionen integrieren und intelligent, einfach zu bedienen und leistungsstärker sind.
4. Beschallungssystem
Beim Beschallungssystem ist darauf zu achten, dass es die Anforderungen an Schallleistung und Gleichmäßigkeit des Schallfelds erfüllt; die korrekte Aufhängung der Lautsprecher kann die Klarheit der Beschallung verbessern, Schallverluste und akustische Rückkopplungen reduzieren; die Gesamtleistung des Beschallungssystems sollte zu 30–50 % als Reserve eingeplant werden; verwenden Sie drahtlose Monitoring-Kopfhörer.
5. Systemverbindung
Impedanz- und Pegelanpassung sind bei der Geräteverschaltung zu beachten. Symmetrie und Unsymmetrie beziehen sich auf einen Referenzpunkt. Bei einem symmetrischen Ein- oder Ausgang ist der Widerstand (die Impedanz) beider Signalenden gegen Masse gleich, die Polarität jedoch entgegengesetzt. Da die an den beiden symmetrischen Anschlüssen empfangenen Störsignale im Wesentlichen den gleichen Wert und die gleiche Polarität aufweisen, können sie sich an der Last der symmetrischen Übertragung gegenseitig aufheben. Daher bietet die symmetrische Schaltung eine bessere Gleichtaktunterdrückung und Störfestigkeit. Die meisten professionellen Audiogeräte verwenden symmetrische Verbindungen.
Für den Lautsprecheranschluss sollten mehrere kurze Lautsprecherkabel verwendet werden, um den Leitungswiderstand zu reduzieren. Da der Leitungswiderstand und der Ausgangswiderstand des Leistungsverstärkers den Q-Faktor des Lautsprechersystems im Tieftonbereich beeinflussen, verschlechtert sich das Einschwingverhalten im Tieftonbereich, und die Übertragungsleitung erzeugt Verzerrungen bei der Audiosignalübertragung. Aufgrund der verteilten Kapazität und Induktivität der Übertragungsleitung weisen beide bestimmte Frequenzcharakteristika auf. Da sich das Signal aus vielen Frequenzkomponenten zusammensetzt, sind die durch die verschiedenen Frequenzkomponenten verursachten Verzögerungen und Dämpfungen bei der Übertragung unterschiedlich, was zu Amplituden- und Phasenverzerrungen führt. Generell treten Verzerrungen immer auf. Theoretisch würde die verlustfreie Übertragungsleitung R = G = 0 keine Verzerrungen verursachen, absolute Verlustfreiheit ist jedoch unmöglich. Bei begrenzten Verlusten gilt für die verzerrungsfreie Signalübertragung L/R = C/G, in der Praxis entspricht das Verhältnis L/R jedoch immer L/R.
6. Systemdebugging
Vor der Justierung muss die Systempegelkurve so eingestellt werden, dass der Signalpegel jedes Pegels innerhalb des Dynamikbereichs des Geräts liegt. Dadurch werden nichtlineare Verzerrungen durch zu hohe oder zu niedrige Signalpegel vermieden, die zu einem schlechten Signal-Rausch-Verhältnis führen. Bei der Einstellung der Systempegelkurve ist die Pegelkurve des Mischers von entscheidender Bedeutung. Nach der Pegeleinstellung kann die Frequenzgangcharakteristik des Systems optimiert werden.
Moderne professionelle elektroakustische Geräte mit höherer Qualität weisen im Allgemeinen einen sehr linearen Frequenzgang im Bereich von 20 Hz bis 20 kHz auf. Nach mehrstufiger Verschaltung, insbesondere mit Lautsprechern, kann dieser jedoch beeinträchtigt sein. Eine präzisere Justierungsmethode ist die Verwendung eines Spektrumanalysators mit rosa Rauschen. Dabei wird rosa Rauschen in das Soundsystem eingespeist, über die Lautsprecher wiedergegeben und der Ton mit einem Testmikrofon an der optimalen Hörposition im Raum aufgenommen. Das Testmikrofon wird an den Spektrumanalysator angeschlossen, der den Amplituden-Frequenzgang des Soundsystems anzeigt. Anschließend wird der Equalizer anhand der Messergebnisse sorgfältig justiert, um einen linearen Frequenzgang zu erzielen. Nach der Justierung empfiehlt es sich, die Signalverläufe der einzelnen Pegel mit einem Oszilloskop zu überprüfen, um mögliche Verzerrungen durch zu starke Equalizer-Anpassungen festzustellen.
Bei Systemstörungen ist Folgendes zu beachten: Die Versorgungsspannung muss stabil sein; das Gehäuse jedes Geräts muss gut geerdet sein, um Brummgeräusche zu vermeiden; Signal-Ein- und -Ausgang müssen symmetrisch sein; lose Verkabelung und unregelmäßige Lötstellen sind zu vermeiden.
Veröffentlichungsdatum: 17. September 2021